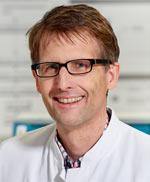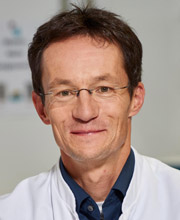Procalcitonin und CRP: Differenzierung von Infektionen der Atemwege und Steuerung der Antibiotikatherapie
Wir leben in einer Zeit des Wettlaufs zwischen Wirksamkeit der Antibiotikatherapie und Resistenzentwicklung der Mikroorganismen. Eine rationale Antibiotikastrategie ist ein essenzieller Baustein, um diesen Wettlauf nicht zu verlieren. In der aktualisierten S3-Leitlinie von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie von 2021 (1) wurde der Stellenwert der Biomarker CRP (C-reaktives Protein) und PCT (Procalcitonin) bei der Differenzialdiagnostik und Therapiesteuerung hilfreich herausgearbeitet.
Differenzierung zwischen bakterieller und viraler Infektion
Bei vergleichbarer Klinik ist es eine Herausforderung, zwischen viraler und bakterieller Infektion zu unterscheiden. Da bei einer viralen Infektion keine Antibiose indiziert ist, ist eine leichtfertige Antibiotikaverordnung möglichst zu umgehen, um Resistenzentwicklungen zu vermeiden.
Schätzungsweise 75% aller Antibiotikagaben erfolgen bei Atemwegsinfektionen - einer der häufigsten Gründe für Arzt-Patienten-Kontakte. Die Herausforderung besteht darin, die Patientinnen und Patienten, die so schnell wie möglich einer antimikrobiellen Therapie bedürfen, von denen zu differenzieren, die z.B. eine viral bedingte Infektion ohne Antibiotikabedarf haben. Klinisch hat sich gezeigt, dass diese Unterscheidung sehr schwierig bis nahezu unmöglich ist, wenn eine radiologische Beurteilung nicht rechtzeitig oder gar nicht gemacht wird (2). Da aber der Stellenwert der radiologischen Abklärung im ambulanten Setting sehr gering ist, spielen Biomarker eine hilfreiche und unterstützende Rolle.
Für eine zielgerichtete Diagnostik und Therapie kann auch eine mikrobiologisch, kulturelle Erregersuche genauso wie eine molekulargenetische PCR-Analytik aus respiratorischem Material erfolgen. Hierbei kann vor allem durch die kulturelle Nachweismethode die Frage nach etwaigen Resistenzen des Erregers geklärt werden. Bei Diagnostik im Rahmen der infektiologischen Abklärung mit fraglicher Antibiotikatherapie kann die Ausnahmekennziffer 32004 in ihrer Praxis hinterlegt werden (gilt nicht für CRP). Somit wird der Wirtschaftlichkeitsbonus nicht belastet.
Entzündungsmarker - für Diagnose und Verlaufsbeurteilung hilfreiche Biomarker
Zur serologischen Diagnostik bei einer Infektion eignen sich die Entzündungsmarker wie Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), Blutbild, CRP (C-reaktives Protein) und Procalcitonin (PCT). Hierbei haben diese sensitiven Marker nicht nur einen diagnostischen Wert, sondern können auch sehr gut zur Therapiesteuerung eingesetzt werden.
Die Anforderung an einen Biomarker besteht darin, die Validität der Diagnose einer Pneumonie zu erhöhen. Eine prospektive Studie in der Primärversorgung zeigte eine gute Korrelation von CRP- und PCT-Werten mit einer radiologisch nachgewiesenen Pneumonie. Durch den Einsatz dieser Biomarker konnte - bei klinisch vergleichbarem Ausgang - die Anzahl der Verschreibungen antimikrobieller Therapien signifikant gesenkt werden (3, 4). Insgesamt liegen mehr Daten für PCT vor, die diesem Biomarker auch eine höhere „diagnostische Effektivität“ zuschreiben.
Vermeidung unnötiger Antibiotikatherapien durch den Einsatz von Biomarkern
Eine in Norddeutschland durchgeführte Studie unter Einschluss von 45 Praxen zeigte eine signifikante Senkung der antimikrobiellen Medikation um 41,6% unter Einsatz von PCT. Auch in einer Metaanalyse wird PCT als effektiv zur Vermeidung von Antibiotika in der ambulanten Primärversorgung beschrieben (5).
Insgesamt muss beachtet werden, dass die klinische (Vortest-) Wahrscheinlichkeit für eine bakterielle Infektion entscheidend für die prädiktive Aussagekraft eines Biomarkers ist (Tab. 1). Je klinisch wahrscheinlicher die Diagnose ist, desto größer ist die Aussagekraft. Des Weiteren ist zu bedenken, dass in der Dynamik eines Entzündungsprozesses ein einmalig unauffälliger Biomarker-Wert eine bakterielle Infektion nicht ausschließt (6). Im Verlauf steigt das PCT im Vergleich zum CRP nach Infektionsbeginn schneller an und fällt nach erfolgreicher Therapie schneller wieder ab.
Tab. 1: Entscheidungshilfe Biomarker: Antibiotikatherapie ja oder nein?
| PCT Wert in ng/ml (entspricht µg/l) | Antibiotikatherapie | Möglichkeit einer bakteriellen Infektion |
| < 0,1 | Sehr abzuraten | Bakterielle Infektion sehr unwahrscheinlich |
| ≥ 0,1 - < 0,25 | Nicht empfohlen | Bakterielle Infektion unwahrscheinlich – jedoch nicht ausgeschlossen. Je nach klinischer Situation/(Ko-) Morbidität, PCT-Verlaufskontrolle oder Antibiotikatherapie erwägen. |
| ≥ 0,25 - < 0,5 | Eher empfohlen | Bakterielle Infektion möglich |
| ≥ 0,5 | Sehr zu empfehlen | Deutet auf bakterielle Infektion hin |
Orientierender Procalcitonin-gesteuerter Algorithmus zur Antibiotikatherapie bei Infektionen der Atemwege (7)
Im Rahmen der Nutzung von CRP und PCT zur Verlaufsbeurteilung empfiehlt sich eine Bestimmung initial sowie im Verlauf nach 3-4 Tagen nach Beginn der antimikrobiellen Therapie. Bei Diskrepanzen zur klinischen Entwicklung empfiehlt sich eine weitere Bestimmung. Im Falle eines Ansprechens auf die Therapie sollten die Werte abfallen. Bei ungenügendem Abfall (< 25-50% vom Ausgangswert) muss ein Therapieversagen mit in Betracht gezogen werden (8). Ein CRP-Rückgang um 50% vom Ausgangswert ist ein Hinweis auf eine günstige Prognose mit Therapieansprechen. Ein unzureichender Rückgang (von CRP bzw. PCT) < 50% - oder gar ein Anstieg - innerhalb von 3 Tagen nach Therapiebeginn kann auf ein Therapieversagen hinweisen (8, 9). Der Verlauf von Biomarker-Messwerten allein rechtfertigt jedoch nicht die Diagnose eines Therapieversagens.
Unterstützung durch Biomarker für den Therapiestopp einer Antibiotikatherapie
Die Strategie, die Therapiedauer über Biomarker (v.a. PCT) zu steuern, wurde vielseitig untersucht. Die Voraussetzung ist, dass die Biomarker (v.a. PCT) im Verlauf möglichst standardisiert bestimmt und klare Therapie-Stopp-Werte beschrieben werden. Hierbei gibt es beispielsweise folgende Möglichkeit (Tab. 2).
Tab. 2: Möglichkeit der Steuerung der Therapiedauer über PCT
| Klinik der Pneumonie | Vorgehen | Stopp-Strategie | Resultat bei gleichem Therapieergebnis |
| Leichte Form, ambulant behandelt | PCT-Bestimmung initial sowie kurzfristige Kontrolle binnen 6-24 h und am Tag 4 ,6, 8 | Therapieende bei PCT-Wert von ≤ 0,25 ng/ml | Mediane Verkürzung der Therapiedauer von 7 auf 5 Tage |
| Leichte bis mittel-schwere Form (hospitalisiert) | PCT-Bestimmung initial sowie kurzfristige Kontrolle binnen 6-24 h und am Tag 4, 6, 8 | Therapieende bei Werten von ≤ 0,25 ng/ml. Bei „hohen Spiegeln“ Abfall ≥ 90% | Mediane Verkürzung der Therapiedauer von 12 auf 5 Tage |
| Schwerwiegend | PCT-Bestimmung täglich | Therapieende bei Spiegeln < 0,5 ng/ml oder Rückgang > 80% vom höchsten Wert | Verkürzung der Therapiedauer von 10,5 auf 5,5 Tage |
Studien, die PCT zur Steuerung der Therapiedauer untersucht haben (10, 11).
| Das PCT kann neben einer bakteriellen Infektion auch im Rahmen anderer klinischer Situationen erhöht sein: | Das CRP kann als unspezifischer Entzündungsmarker auch bei anderen Pathologien erhöht sein: |
- invasive Pilzinfektionen
- schwerer Leberzirrhose
- akute oder chronische Hepatitis
- kleinzelliges Lungenkarzinom
- medulläres C-Zell-Karzinom der Schilddrüse etc.
| - rheumatologische und autoimmunologische Prozesse
- chronisch entzündliche Erkrankungen
- Neoplasien
- Nekrosen etc.
|
Lokalisierte Infektionsherde können trotz bakterieller Genese jedoch auch einen Verlauf mit unauffälligen Biomarker-Werten aufweisen. Insgesamt sollte die Labordiagnostik immer in Zusammenschau mit der klinischen Situation und ggf. weiteren diagnostischen Maßnahmen erfolgen.
Abrechnungen
| Parameter | Material | EBM | GOÄ |
| Ziffer | € | Ziffer | € (1,15-fach) |
| CRP | Serum | 32460 | 4,90 € | 3741 | 13,41 € |
| Procalcitonin | Serum | 32459* | 9,60 € | 3744 | 30,16 € |
* Die GOP 32459 wurde unter der Ausnahmekennziffer 32004 aufgenommen.
Wichtig! Keine Belastung des Laborbudgets der Praxis
Bei der Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines ggf. erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung ist jeder Behandlungsfall mit der EBM-Ausnahmekennziffer 32004 zu kennzeichnen. Die Untersuchung ist dann von der Berechnung des Wirtschaftlichkeitsbonus ausgenommen und belastet nicht das Laborbudget der Praxis.